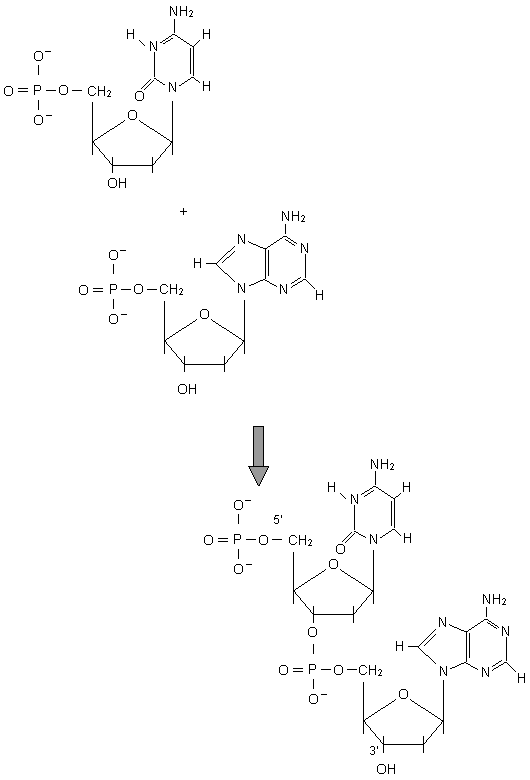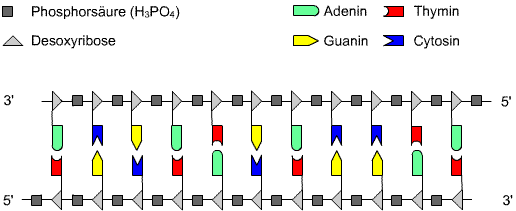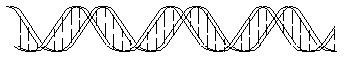|
Nucleinsäuren bestehen aus miteinander verknüpften Nucleotiden. Man unterscheidet entsprechend dem Zucker zwischen Desoxyribonucleinsäure (desoxyribonucleic acid, DNA) und Ribonucleinsäure (ribonucleic acid, RNA). Weniger gebräuchlich sind die deutschen Abkürzungen DNS und RNS.
DNA enthält den Bauplan zur Synthese der Proteine. Sie kommt in den Zellkernen als Bestandteil der Chromosomen vor und wird bei der Zellteilung nach vorheriger Verdoppelung (Replikation) an die Tochterzellen weitergegeben. Da die Proteinsynthese im Cytoplasma an den Ribosomen stattfindet, muss die DNA abgeschrieben werden (Transkription). Die dabei entstehende mRNA kann den Zellkern verlassen.
RNA unterscheidet sich von DNA durch folgende Merkmale
RNA ist an der Replikation der DNA beteiligt (Primer-RNA) und hat verschiedene Funktionen bei der Proteinsynthese. An der Proteinbiosynthese sind verschiedene Arten von RNA beteiligt:
Nukleotide können zu langen Ketten (Polynukleotide) verknüpft werden. Dabei werden die Zucker zweier benachbarter Nukleotide über die Phosphorsäure durch Phosphodiesterbindung miteinander verknüpft.
Bei der DNA handelt es sich beim Zucker immer um Desoxyribose. Jedes Desoxyribosemolekül kann am C1-Atom eine von vier verschiedenen Stickstoffbasen als freie Reste tragen. Zwei dieser Basen, nämlich Adenin (A) und Guanin (G), gehören zu den Purinen, die beiden anderen, Cytosin (C) und Thymin (T), sind Pyrimidinbasen. Die Atome des Zuckermoleküls sind gestrichen nummeriert, während für die Atome der Basen ungestrichene Zahlen verwendet werden. Aus räumlichen Gründen können immer die Basen Adenin und Thymin bzw. Guanin und Cytosin über Wasserstoffbrücken eine Verbindung eingehen. Die sich jeweils ergänzenden Basen, also z.B. Adenin und Thymin nennt man komplementäre Basen. Zwischen Cytosin und Guanin werden drei, zwischen Adenin und Thymin zwei Wasserstoffbrücken ausgebildet. An einen bestehenden DNA-Strang kann also durch Verbindung mit komplementären Basen ein zweiter, komplementärer DNA-Strang gebildet und gebunden werden, so dass der typische DNA-Doppelstrang entsteht. Das hydrophile Rückgrat aus Zucker und Phosphat liegt an der Aussenseite, während die hydrophoben Basen im Inneren der Helix stecken.
Abb. 2: Symbolische Darstellung der DNA als Doppelstrang. Da sich immer zwei komplementäre Basen ergänzen, wird durch die Basensequenz (Reihenfolge der Nukleotidbasen) der einen Polynukleotidkette automatisch die Sequenz der anderen festgelegt. Die 46 Chromosomen des Menschen enthalten knapp 6 x 109 Nukleotidpaare. Von der chemischen Struktur her gibt es ein 3’-Ende mit einer Hydroxylgruppe, die am 3’-Atom des Zuckers hängt und ein 5’-Ende mit einer Phosphatgruppe am 5’-Atom des Zuckers. Die Polynukleotidketten sind jedoch keine linearen Gebilde sondern spiralig umeinander gewunden. Diese räumliche Struktur ist von Watson und Crick (Nobelpreis 1962) als rechtsgängige Doppelhelix erkannt worden:
Die Doppelhelix der DNA kann ihrerseits nochmals zu einer Superhelix verdrillt sein. Diese Superspiralisierung wird durch Topoisomerasen bewirkt. Als Mass für die Kettenlänge verwendet man die Anzahl der Basenpaare in Einheiten von 1000 Basen (kb = Kilobasen).
Bei Körpertemperatur und physiologischem
pH sind DNA-Helices sehr stabil. Dieser als Denaturierung bezeichnete Prozess kann über die ganze DNA oder nur über einen Teil (Teildenaturierung) stattfinden. Kovalente chemische Bindungen werden dabei allerdings nicht gelöst. Jede DNA hat eine charakteristische Denaturierungs- oder Schmelztemperatur. Diese liegt umso höher, je grösser der Anteil an Guanin-Cytosin-Bindungen (CG-Bindungen) ist.
Die Endbereiche der Chromosomen werden als Telomere bezeichnet. Sie bestehen aus einer tausendfachen Wiederholung der Sequenz TTAGGG. Trotz ihrer Monotonie sind sie von grosser Bedeutung für die Chromosomen. Sie wirken wie Schutzkappen in dem sie das Chromosom vor dem Abbau schützen und End-zu-End Fusionen von Chromosomen verhindern . Bei der DNA-Replikation kann der RNA-Primer am 5'-Ende nicht durch DNA ersetzt werden, so dass bei jeder Replikation ein kleiner Teil der DNA verloren geht. Dies bedeutet, dass die Telomere bei jeder Zellteilung etwas kürzer werden. Nach einigen Dutzend Zellteilungen ist das Telomer aufgebraucht, die Zelle kann sich nicht mehr teilen und stirbt ab. In den Keimzellen der Hoden (Testes) und Ovarien (sowie häufig in Tumoren) kann ein Enzym namens Telomerase die verlorengegangenen Stücke wieder ersetzen. Sie besteht aus einem Protein und einem RNA-Molekül, das als Vorlage für die Telomersynthese dient. In den meisten menschlichen Zellen ist die Telomerase nur während der Embryonalzeit aktiv und wird, nachdem die Telomere genügend lang sind, abgeschaltet. Im Ausgangszustand sind diese Schutzkappen bis 20'000 Basenpaare (bp) lang. Da die Telomersequenzen mit jeder DNA-Verdoppelung, d.h. Zellteilung, etwa 50-200 bp verlieren, dient die Länge des Telomers als Mass für das Alter einer Zelle.
In einem besonderen Teil des Zellkernes, dem Nucleolus, werden RNA- und proteinhaltige Teilchen zusammengesetzt, die dann durch die Kernporen ins Cytoplasma wandern und dort nach weiterer Abwandlung zu Ribosomen werden.
|
||||||||||||
|
20.02.2001 /hpk |